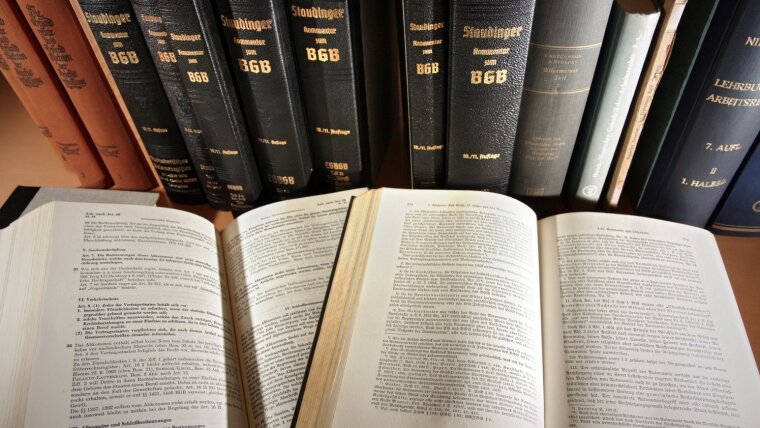
Im Sommersemester 2026 werden die folgenden Veranstaltungen angeboten:
-
S - Soziokulturelle Voraussetzungen von Recht, Staat und Demokratie
Wie alle Systeme leben auch Recht, Staat und Demokratie von Voraussetzungen, die sie nicht selbst garantieren können. Sie sind angewiesen auf ihnen günstige Bedingungen, die ihrer Erhaltung und Entwicklung zuträglich sind. Das Seminar verfolgt die Zielsetzung, entsprechende Bedingungsverhältnisse für das Gelingen normativer Ordnungsentwürfe namenhaft zu machen. Aus der Evolutionstheorie ist die Verknüpfung von Variation und Selektion bekannt; hier spielt u.a. die Anpassungsfähigkeit an Umweltbedingungen eine maßgebliche Rolle. Zu dem breiten Spektrum der soziokulturellen Voraussetzungen sozialer Systeme gehören nicht zuletzt die Verfügbarkeit entsprechender Kommunikationsmedien und ‑foren, politisch entgegenkommende Moralvorstellungen, normative Gewohnheiten und religiöse Traditionen, institutionelle und gesellschaftliche Strukturen sowie mentale Dispositionen.
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Dieses berühmte sog. Böckenförde-Diktum hatte die Pointe, dass die Freiheitlichkeit eines Systems nicht garantiert werden kann, ohne die Freiheit selbst zu gefährden oder sogar zu zerstören. Hierbei handelt es sich um eine sehr spezifische Überlegung, die den freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat daran hindert, seine eigenen Erhaltungsbedingungen nach Art totalitärer Systeme zu erzwingen. Das liefert Maßgaben etwa für Demokratiefördergesetze, wie sie derzeit auf der politischen Agenda stehen. Auch die staatliche Einflussnahme auf das Erziehungssystem, die Zivilgesellschaft und die religiöse Landschaft erfahren von hierher eine deutliche Begrenzung.
Das Seminar widmet sich damit Spannungsverhältnissen zwischen Positionen des Individualismus einerseits und Gemeinschafts- respektive Gemeinwohlerfordernissen andererseits. Eine weitreichende Demokratisierung vermag liberale Grundelemente zu unterminieren, ungezügelte libertäre Strömungen hingegen die Legitimität demokratischer Mehrheitsentscheidungen zu unterlaufen. Welche Optionen hat dabei der freiheitlich-demokratische Verfassungsstaat, sich selbst und das Vorfeld seiner eigenen Voraussetzungen unter Stabilitätsgesichtspunkten zu organisieren? Die Generierung und der Erhalt von politischem Vertrauen dürften hierbei eine zentrale Rolle spielen. Auch die Output-Orientierung staatlicher Legitimation verdient Beachtung. Ebenso stellen sich eine Reihe von Fragen, die die Abhängigkeit des Staates von Dispositionen seiner Bürger betreffen, insbesondere im Hinblick auf deren bürgerschaftliches Engagement sowie (Verfassungs)Patriotismus – einschließlich deren mediale Beeinflussung durch fake news oder (ausländische) „Propaganda“.
Ideengeschichtlich reicht der Arm dieser Überlegungen weit und deutet auf unterschiedliche Theorietraditionen hin. Bereits Hegel hat die Bedeutung von Institutionen für den Erfolg politisch-rechtlicher Ordnungsbildung herausgearbeitet. Auch die maßgeblich von Habermas geprägte Theorielinie der deliberativen Demokratie und diskursiven Legitimation des Rechts setzt auf eine „entgegenkommende Lebensform“, die bei der Frage, ob sich Akteure überhaupt in einen legitimationsstiftenden Diskurs begeben, mitgedacht werden muss. Eine Diskurstheorie, die vom Prinzip des „zwanglosen Zwangs des besseren Arguments“ zehrt, droht demnach an ihre Grenzen zu stoßen, wenn sie in Zeiten offener Demokratiefeindschaft von Voraussetzungen zu leben scheint, die sie selbst im Zweifel nicht erzwingen kann. Eine stärker an Hegel orientierte Ausprägung dieser Intuition wurde in jüngerer Zeit von Honneth aufgegriffen, indem er in bestehenden gesellschaftlichen Institutionen – und da insbesondere der Organisation der Arbeit – Formen der intersubjektiven Vergesellschaftung vorfindet, die das Potenzial bergen, unter Anleitung eines normativen Ideals in einer Weise organisiert zu werden, die jenes Bewusstsein der reziproken Abhängigkeit der Menschen herzustellen vermag, welches einen Grundpfeiler der demokratischen Lebensform darstellt.
Die Veranstaltung ist als Blockseminar konzipiert. Zudem werden im Laufe des Semesters an einzelnen Terminen ausgewählte Primär- wie Sekundärtexte zum Seminarthema gelesen und diskutiert. Das Seminar ist sowohl als Übungs-, als auch als Examensseminar angedacht und ist offen für Studierende der Schwerpunkte 1, 7 und 8. Literaturhinweise, Terminfindung und thematische Orientierung erfolgen in einer Vorbesprechung, welche am 9. April 2026 um 16:00 Uhr (Raum folgt) stattfindet.
Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail an die Adresse tim.niendorf@uni-jena.de sowie über Friedolin für die Veranstaltung an. Die Anmeldung für die Wissenschaftlichen Examensseminararbeiten muss bis zum 28. Februar 2026 erfolgen, die Anmeldung für Übungsseminararbeiten ist auch nach diesem Termin möglich. Studierende, welche planen, ihre Wissenschaftliche Examensseminararbeit in diesem Seminar zu erbringen, melden sich bitte zudem zum gleichnamigen Examens-Externer Link und ÜbungsseminarExterner Link auf Friedolin an.
Studierende, die ihre Wissenschaftliche Arbeit im Seminar schreiben, erhalten nach der Anmeldung ein Formular, das ausgefüllt per E-Mail zusammen mit einer eingescannten Datei des Übungsseminarscheins zurückzuschicken ist.
-
V - Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Argumentationslehre
Die Vorlesung führt in Grundpositionen sowie Grundlagen der Rechtsphilosophie, juristischen Methoden- und Argumentationslehre ein.
Die Veranstaltung dient dem Erwerb des Grundlagenscheins Rechtsphilosophie gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 1 ThürJAPO. Hierfür wird am Ende des Semesters eine Abschlussklausur angeboten. Bitte melden Sie sich in FriedolinExterner Link für die Veranstaltung an.
-
V - Rechts- und Staatsphilosophie
Die Schwerpunktvorlesung behandelt in vertiefter Auseinandersetzung mit den Grundpositionen der Rechtsphilosophie Fragen der Pflichtbegründung und Normgeltung in Recht und Moral. Nach einem historischen Abriss widmet sich die Veranstaltung Fragen der Willensfreiheit und Zurechnung, der Menschenrechte, der Achtung und der Solidarität sowie Verantwortung nicht zuletzt gegenüber der menschlichen Umwelt.
Die Veranstaltung ist dem Schwerpunktbereich 1 „Grundlagen des Rechts“ gem. § 5 Abs. 1 SBPrüfO zuzuordnen. Eine Abschlussklausur gem. § 15 SBPrüfO wird am Ende des Semesters angeboten. Bitte melden Sie sich in FriedolinExterner Link für die Veranstaltung an.
Literaturempfehlung:
Mahlmann, Matthias, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, 7. Aufl., 2023
-
Ü - Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene
Die Übung vermittelt den Lernstoff im Öffentlichen Recht in der Breite und Tiefe, in der er Gegenstand der Pflichtfachprüfung im Ersten Examen ist. Die Besprechungsstunden werden in der Hauptsache der Methodik der Fallbearbeitung einschließlich der Sachverhaltsanalyse und der Subsumtionstechnik gewidmet sein.
Kenntnisse im Staats- und Verwaltungsrecht, insbesondere im Kommunal-, Polizei- und Baurecht sowie auch im Verwaltungsprozessrecht sind unabdingbar.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene ist eine erfolgreich abgeschlossene Zwischenprüfung und eine zuvor angefertigte Probehausarbeit im Öffentlichen Recht, die mit mindestens 4 Punkten bewertet ist (§ 6 Abs. 2 StudO). Bitte melden Sie sich in FriedolinExterner Link für die Veranstaltung an.
Informationen zur Hausarbeit:
- Der Hausarbeitssachverhalt wird am 09.02.2026, 12:00 Uhr, auf dem Prüfungsserver hochgeladen.
- Die Abgabefrist endet am 07.04.2026 um 23.59 Uhr.
- Für die Formalia beachten Sie bitte die Bearbeitungshinweise im Prüfungsraum sowie die dort ebenfalls zu findenden Leitlinien der Fakultät zu den Formalia von Hausarbeiten.
- Es müssen verpflichtend die unterschriebene Eigenständigkeitserklärung sowie die unterschriebene Versicherung über die Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis auf dem Prüfungsserver eingereicht werden. Erst wenn diese separaten Abgaben erfolgt sind, erscheint die Abgabemöglichkeit für die Hausarbeit im Prüfungsraum.
- Die Hausarbeit ist ausschließlich über den Prüfungsserver digital und anonymisiert einzureichen. Es ist keine gedruckte Version abzugeben.
- Einen ggf. zu stellenden Schnellkorrekturantrag reichen Sie bitte ebenfalls über die entsprechende Abgabe auf dem Prüfungsserver ein.
Zugangsdaten:
Link für die Selbsteinschreibung: https://exam.uni-jena.de/course/view.php?id=406Externer Link
Zugangsschlüssel: 5LQW8KL69V
Zudem wird der Nachweis benötigt, dass Sie an der Übung teilnehmen dürfen.
Bitte laden Sie hierfür Ihr Zwischenprüfungszeugnis sowie Ihren Schein über das Bestehen der Probehausarbeit (Staatsorganisationsrecht oder Europarecht) als PDF hoch. Dies ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Übung und somit zwingend einzureichen. Nutzen Sie hierfür den Prüfungsserver (https://exam.uni-jena.de/course/view.php?id=406Externer Link), Zugangsschlüssel: 5LQW8KL69V, auf dem auch die Hausarbeitsabgabe erfolgt.
Im Wintersemester 2025/26 werden die folgenden Veranstaltungen angeboten:
-
S - Recht, Staat und Revolution
Nähert man sich den Disziplinen der Rechtsphilosophie, Verfassungstheorie und Rechtsgeschichte über den analytischen Zugriff der Revolutionstheorien, so wird man auf grundlegende Strukturfragen von Staat, Gesellschaft und Politik gestoßen – eben diesen Blickwinkel einzunehmen, strebt das Seminar an.
So zentral bei diesen Betrachtungen die einschneidende Bedeutung der „Doppelrevolutionen“ der Neuzeit in den Amerikanischen Kolonien sowie in Frankreich im ausgehenden 18. Jahrhundert war, darf dabei der Blick auf die lange Begriffsgeschichte und den fundamental anderen Bedeutungsgehalt der „Revolution“ in der vormodernen Zeit nicht abhanden kommen. Verstand man unter einer Revolution nämlich zunächst das höchst konservative Konzept einer „Rückkehr bzw. Zurückwälzung zum Alten“ – einer revolutio als das Gegenteil einer evolutio –, so wandelte sich dieses Verständnis im späten 18. Jahrhundert. „Revolutionen“ waren nunmehr die positive Errichtung einer Staatsordnung, verbunden mit dem damit erfolgenden Bruch mit dem bisherigen System unter Auswechslung der Legitimationsgrundlage staatlicher Herrschaft – Volkssouveränität statt Gottesgnadentum. Dieses Moment, welches unser heutiges Verständnis einer Revolution prägt, wurde etwa von Hannah Arendt emphatisch als Gründungsakt einer Republik stilisiert und mit „Natalität“ einer politischen Gemeinschaft auf einen Begriff gebracht: „Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen“ (Augustinus).
Mit diesem essenziellen Wechsel des Bedeutungsgehalts der Begriffe des Staatsrechts in der sog. „Sattelzeit“ (R. Koselleck) um das Jahr 1800 eröffnen sich für die rechtswissenschaftliche Betrachtung des Verhältnisses von „Recht, Staat und Revolution“ mannigfaltige Forschungsfragen. Im Seminar bieten sich Arbeiten zur Rechtsphilosophie wie Rechtsgeschichte an. Während der philosophische Zugriff etwa beim Verhältnis zwischen Naturrecht und Kodifizierung der Menschen- und Bürgerrechte ansetzen kann, stößt ein sozialphilosophischer Blick auf die theoretische Landschaft des 19. und 20. Jahrhunderts etwa auf die marxistische Revolutionstheorie, die nach der proletarischen Revolution das notwendige „Absterben des Staates“ wie des Rechts glaubt heraufziehen zu sehen.
Doch auch für das Interesse rechtshistorisch orientierter Studierender bietet das Seminar zahlreiche Anknüpfungspunkte: Speziell in der deutschen Geschichte, die Ereignisse der Jahre 1848/1849, die Revolution 1918/1919, ferner die dahingehend umstrittenen Etappen der Machtergreifung der Nationalsozialisten („legale“ resp. „nationale Revolution“) sowie schließlich die „Friedliche Revolution“ der Jahre 1989/1990.
Ferner (aber nicht abschließend) erlauben sich prospektive und philosophisch angereicherte Überlegungen zum Staatsaufbau: So sieht Hannah Arendt das legitimatorische Problem, dass spätere Generationen nicht länger die Erfahrung der revolutionären Generation teilen, als pouvoir constituant zu fungieren. Bis in unsere Zeiten gefühlter und vielleicht realer Absenz demokratischer Selbstwirksamkeit versuchen Konzepte deliberativer Demokratie, etwa in Form der Diskurstheorie des Rechts von Jürgen Habermas, hierauf auf eine institutionelle Antwort zu geben.
Die Veranstaltung ist als Blockseminar konzipiert. Zudem werden im Laufe des Semesters an einzelnen Terminen ausgewählte Primär- wie Sekundärtexte zum Seminarthema gelesen und diskutiert. Das Seminar ist sowohl als Übungs-, als auch als Examensseminar angedacht und ist offen für Studierende der Schwerpunkte 1, 4 und 6. Literaturhinweise, Terminfindung und thematische Orientierung erfolgten in einer Vorbesprechung, welche am 16. Oktober 2025 stattfand.
Die Anmeldefrist ist bereits verstrichen.
-
V - Grundzüge der Rechtstheorie und Rechtssoziologie einschließlich Methodenlehre
Die Vorlesung führt in Grundpositionen sowie Grundlagen der Rechtstheorie, Rechtssoziologie und juristischen Methodenlehre ein.
Die Veranstaltung dient dem Erwerb des Grundlagenscheins Rechtssoziologie gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 1 ThürJAPO. Hierfür wird am Ende des Semesters eine Abschlussklausur angeboten. Bitte melden Sie sich in FriedolinExterner Link für die Veranstaltung an.
-
V - Rechtstheorie und Rechtssoziologie
Die Vorlesung vertieft beide schon aus dem Grundstudium bekannten Materien in Form wissenschaftlicher Erörterung einer Theorie des Rechts und der Rechtswissenschaft samt ihren gesellschaftlichen Bezügen. Auf dem Feld der Rechtstheorie soll insbesondere die Frage der Rechtsgeltung behandelt werden. Warum sind Menschen überhaupt gehalten, Normen zu befolgen oder sogar zu akzeptieren? Auf dem Gebiet der Rechtssoziologie soll u.a. ein Einblick in aktuelle Fragestellungen gegeben werden, wobei u.a. feministische wie antirassistische Zugänge thematisiert werden.
Die Veranstaltung ist dem Schwerpunktbereich 1 „Grundlagen des Rechts und der Rechtswissenschaft“ gem. § 5 Abs. 1 SBPrüfO zuzuordnen. Eine Abschlussklausur gem. § 15 SBPrüfO wird am Ende des Semesters angeboten. Bitte melden Sie sich in FriedolinExterner Link für die Veranstaltung an.